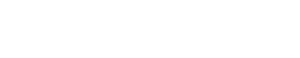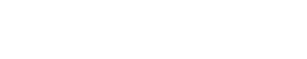Die Chronik des Kellerhauses
Zeitreise: "von Kameniz bis Chemnitz"
Die Chronik des Kellerhauses beginnt mit einer Zeichnung (ca. 1640) von der Stadt Chemnitz und dem bereits 1135 gegründeten Benediktinerkloster – eines der reichsten von Sachsen. Das Kloster gilt somit als der älteste Siedlungsplatz von Chemnitz
Der Verlauf des Chemnitz-Flusses war damals noch "unbegradigt" und auch der Schloßteich wurde bis heute mehrfach durch Menschenhand verändert. Er wurde im 15. Jahrhundert von Benediktinermönchen als Fischzuchtteich angelegt. Um 1879 wurde vom damaligen "Chemnitzer Verschönerungsverein" die Anschaffung von Schwänen für den Schloßteich initiiert. Zu dieser Zeit auch erfreuten sich zahllose Gäste (laut Berichten "in langen Schlangen wartend" am historischen Ruderboot-Verleih) als Gondelgesellschaften auf dem Schloßteich.
Das Kellerhaus fand erstmals Erwähnung in den Ratsakten von 1680 als ,,Keller Häußgen unterm Schloß". Mehrere Bauperioden wurden anhand von Untersuchungen am Fundament nachgewiesen. In den fünf Nischen des 13 Meter langen Kellerganges – dem heutigen "Hilariuskeller" (benannt nach einem sinnes- und lebensfrohen Klosterabt) – wurde Bier gelagert. So wurde also bereits 1698 von einer ,,Gastwirtschaft" geschrieben und ein ,,birkeller" wird neben dem ,,maltzhaus und brauhaus" schon um 1541 im Kloster benannt.
Vom Ende des 17. Jahrhunderts wissen wir, dass das "Kellerhäußgen" von einem gewissen Knobloch betrieben wurde, der um 1686 ein neues Schankhaus errichtete.
Auf den Fundamenten des Kellerganges entstand also zu dieser Zeit das schlichte Fachwerkgebäude, welches wir heute als ,,Kellerhaus" kennen, mit den späteren Anbauten nach Süden (1820) und Norden (1870).
Aus alter Zeit berichtet man, dass das Bier, welches hier ausgeschenkt wurde, lange Zeit ein heißes Streitobjekt war und manchem Ratsherrn und dem Oberamtmann aufregende Beschäftigung einbrachte. Es war streng verboten fremdes Bier auszuschenken, dennoch tranken etliche Zecher lieber das hitzige Braunbier aus Lichtenwalde.
Dieses Vergehen mussten Bürger und Handwerksburschen mit zwei Tagen Haft büßen und auch der Wirt wurde mit einer Strafe belegt. Dieser sogenannte "Bierkrieg" soll über fünf Jahrzehnte gedauert haben. Trotz aller Strafandrohungen des Rates gingen noch so manche "lüsternen Mäuler und ungehorsamen Köpfe" ins Kellerhaus, um dort "frembde Biere zu sauffen und sie schleppten sie sogar in Flaschen und anderen Geväsen" in die Stadt.
Somit geriet Knobloch ins Visier der brauenden Bürgerschaft von Chemnitz, weil er "fremdes Bier" ausgeschenkt habe. 1698 gelang es seinem Nachfolger Franz Lämmel, eine Schankkonzession zu bekommen, jedoch nur für Chemnitzer Braunbier.
Im Jahre 1727 erhielt das Kellerhaus die Konzession auch Lichtenwalder Bier auszuschenken, doch per Eid nur, wenn das neu gebraute Chemnitzer Bier in der Stadt nicht vorhanden war. Mit der Aufhebung des Gesetzes des Bier- und Mahlzwanges im Jahr 1838 gingen die Querelen um die Durchsetzung des Bannmeilenprivilegs endlich zu Ende.